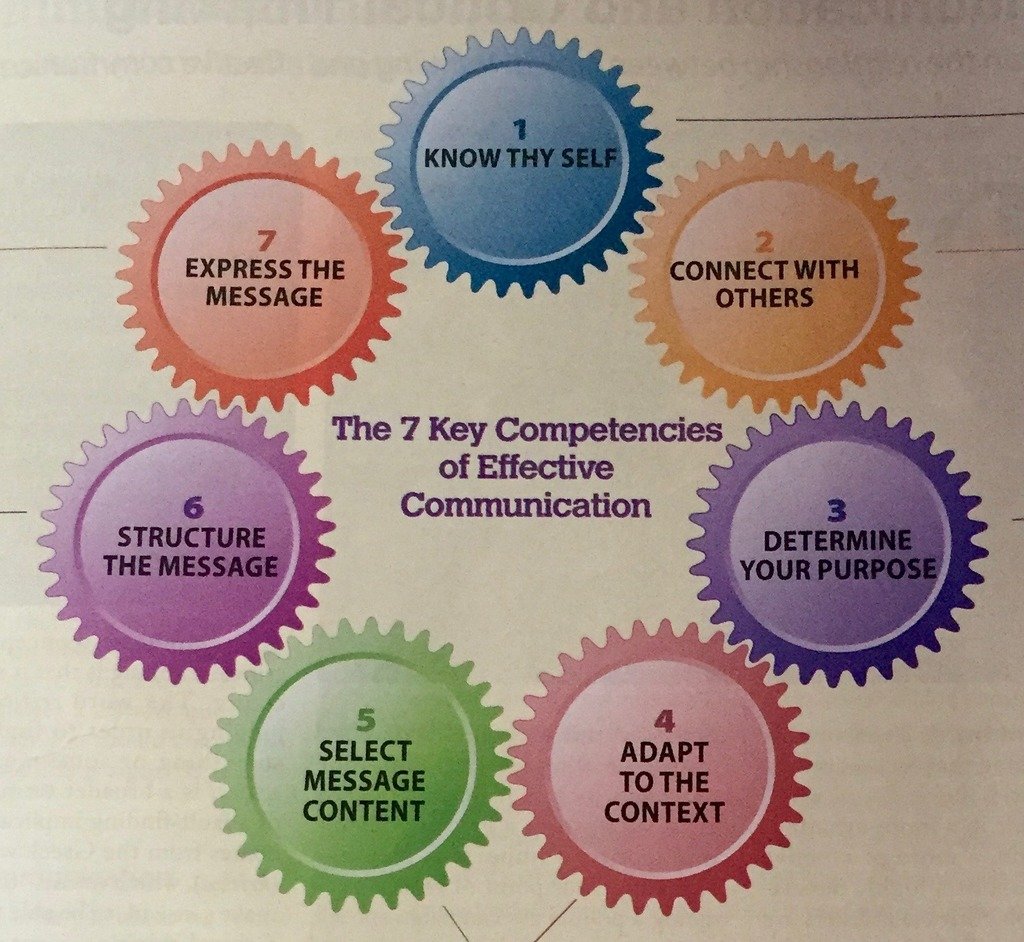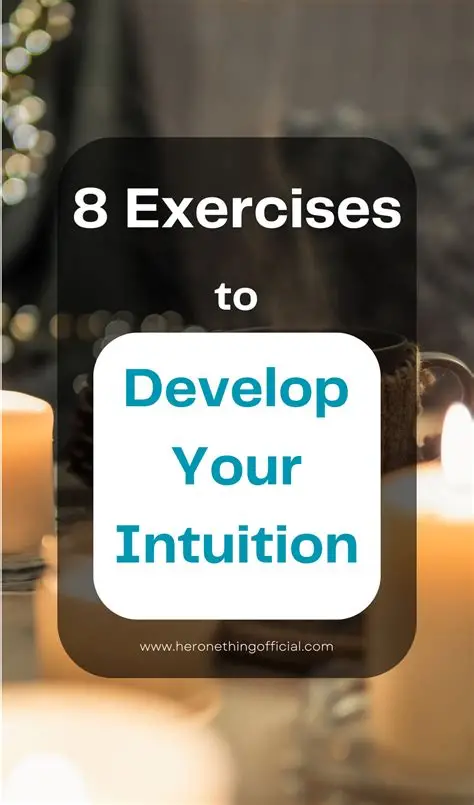Einleitung
In meinen 15 Jahren als Führungskraft habe ich erlebt, wie selbst die klügsten Teams scheitern, wenn die Kommunikation stockt. Was blockiert gute Kommunikation? Diese Frage beschäftigt mich seit meinem ersten Projektdesaster im Jahr 2010, als ein Millionen-Deal platzte, weil niemand die eigentliche Kundenanforderung verstanden hatte. Die Realität ist: Die meisten Kommunikationsprobleme sind hausgemacht und vorhersehbar.
Ich habe gesehen, wie Unternehmen 30-40% ihrer Produktivität verlieren, nur weil grundlegende Kommunikationsmechanismen fehlen. Das Problem liegt selten an mangelnder Technologie oder fehlenden Tools. Was blockiert gute Kommunikation wirklich, sind menschliche Faktoren, organisatorische Strukturen und eingefahrene Verhaltensmuster. Diese Barrieren manifestieren sich in Form von Missverständnissen, verzögerten Entscheidungen und frustrierten Mitarbeitern.
Die gute Nachricht: Kommunikationsblockaden lassen sich systematisch identifizieren und beheben. In diesem Artikel teile ich konkrete Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen. Ich zeige Ihnen, welche Faktoren die Kommunikation tatsächlich behindern und wie Sie diese Hindernisse in Ihrem Unternehmen erkennen und beseitigen können. Dabei verlasse ich mich nicht auf Lehrbuch-Theorie, sondern auf bewährte Methoden, die in der Praxis funktionieren.
Fehlende Klarheit in Zielen und Erwartungen
Was blockiert gute Kommunikation am häufigsten? Aus meiner Erfahrung ist es die mangelnde Klarheit über Ziele und Erwartungen. Ich habe unzählige Meetings erlebt, in denen alle Beteiligten glaubten, dasselbe zu wollen, nur um Wochen später festzustellen, dass jeder eine völlig andere Vorstellung hatte.
Die Sache ist die: Viele Führungskräfte gehen davon aus, dass ihre Vision automatisch verstanden wird. Das ist ein kostspieliger Irrtum. In einem Projekt 2019 verloren wir drei Monate Entwicklungszeit, weil niemand genau definiert hatte, was “benutzerfreundlich” bedeuten sollte. Jede Abteilung hatte ihre eigene Interpretation.
Was ich gelernt habe: Klarheit bedeutet nicht, einmal etwas zu sagen und dann weiterzumachen. Es bedeutet, Ziele zu dokumentieren, Erwartungen zu quantifizieren und regelmäßig abzugleichen. Bei einem Kunden implementierten wir ein einfaches System: Jedes Projekt beginnt mit einem einseitigen Dokument, das die drei Hauptziele, fünf messbare Erfolgskriterien und klare Verantwortlichkeiten definiert.
Die Ergebnisse waren dramatisch. Die Projektlaufzeiten verkürzten sich um durchschnittlich 25%, weil weniger Zeit mit Nachbesserungen und Missverständnissen verloren ging. Mitarbeiter berichteten von deutlich weniger Frustration, weil sie genau wussten, woran sie gemessen wurden.
Der Schlüssel liegt in der Frage: Können alle Beteiligten in eigenen Worten erklären, was das Ziel ist? Wenn nicht, haben Sie ein Klarheitsproblem, das die Kommunikation blockiert.
Hierarchische Strukturen und Angst vor Konsequenzen
Ein weiterer massiver Blocker für gute Kommunikation, den ich immer wieder sehe: die Angst der Mitarbeiter, schlechte Nachrichten nach oben zu kommunizieren. Was blockiert gute Kommunikation hier? Die organisatorische Struktur selbst.
Ich erinnere mich an ein Technologieunternehmen, bei dem ein kritischer Softwarefehler erst vier Wochen nach seiner Entdeckung dem Management gemeldet wurde. Die Entwickler hatten Angst vor den Konsequenzen. Das Ergebnis: Ein Produktlaunch musste um drei Monate verschoben werden, was Millionen kostete.
Die Realität ist: Je hierarchischer eine Organisation, desto stärker wird Information gefiltert. Jede Ebene glättet die Botschaft ein wenig mehr, bis beim Top-Management nur noch Schönfärberei ankommt. Das ist kein böser Wille, sondern menschliche Natur. Menschen wollen gut dastehen, besonders vor Vorgesetzten.
Was funktioniert dagegen? Ich habe in meinen Teams eine Regel eingeführt: Schlechte Nachrichten zuerst. Wer Probleme frühzeitig meldet, wird belohnt, nicht bestraft. Das klingt einfach, aber die Umsetzung erfordert konsequentes Vorleben. Wenn ein Mitarbeiter ein Problem meldet, ist meine erste Reaktion immer: “Danke, dass Sie das ansprechen. Wie können wir helfen?”
Bei einem mittelständischen Unternehmen führte diese kulturelle Änderung dazu, dass kritische Issues durchschnittlich 60% früher eskaliert wurden. Das bedeutete mehr Zeit zur Problemlösung und weniger Feuerwehrübungen kurz vor Deadlines.
Informationsüberflutung und digitale Ablenkung
Was blockiert gute Kommunikation im digitalen Zeitalter? Paradoxerweise: zu viele Kommunikationskanäle. Ich spreche aus Erfahrung – in meinem letzten Unternehmen hatten wir E-Mail, Slack, Teams, WhatsApp, SMS und noch ein internes System. Die Mitarbeiter verbrachten 40% ihrer Zeit damit, verschiedene Kanäle zu checken.
Ich habe 2022 ein Experiment gewagt: Wir reduzierten die Kommunikationskanäle auf zwei – E-Mail für nicht-dringende Themen und Teams für alles Dringende. Alle anderen Tools wurden abgeschaltet. Der Aufschrei war anfangs groß, aber nach vier Wochen berichteten 85% der Mitarbeiter von gesteigerter Produktivität.
Was ich gelernt habe: Weniger ist mehr. Jeder zusätzliche Kanal verdoppelt nicht die Effizienz, sondern verdoppelt das Chaos. Die Kunst liegt darin, klare Regeln zu etablieren: Was kommuniziert man wo? Was ist wirklich dringend?
Ein praktischer Tipp: Implementieren Sie “Deep Work”-Zeiten, in denen Kommunikation minimiert wird. Bei uns sind das zwei Stunden am Vormittag, in denen keine Meetings stattfinden und Nachrichten nur in Notfällen gesendet werden.
Kulturelle und sprachliche Unterschiede
Was blockiert gute Kommunikation in internationalen Teams? Kulturelle Nuancen und Sprachbarrieren, die oft unterschätzt werden. Ich leitete ein Projekt mit Teams in Deutschland, USA und Japan – und die Kommunikationsstile könnten nicht unterschiedlicher sein.
Die Deutschen schätzten direkte, klare Ansagen. Die Amerikaner bevorzugten positive Formulierungen mit viel Kontext. Die japanischen Kollegen kommunizierten indirekt und vermieden direkte Ablehnung. Das Ergebnis: Totales Chaos. Deutsche empfanden Amerikaner als oberflächlich, Amerikaner fanden Deutsche unhöflich, und niemand verstand wirklich, was die japanischen Kollegen dachten.
Der Wendepunkt kam, als wir einen interkulturellen Workshop organisierten. Nicht die übliche Theorie-Schulung, sondern einen praktischen Austausch, wo Teams ihre Kommunikationspräferenzen offen diskutierten. Wir einigten uns auf einen gemeinsamen Kommunikationsstandard, der Elemente aus allen Kulturen integrierte.
Was funktioniert in der Praxis: Dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen schriftlich, auch nach mündlicher Absprache. Kulturelle Missverständnisse entstehen oft, weil jemand dachte, etwas sei vereinbart, während andere etwas anderes verstanden haben. Schriftliche Bestätigung schafft Klarheit.
Ein weiterer Punkt: Investieren Sie in Sprachtraining, aber nicht nur in Grammatik. Wichtiger ist das Verständnis für idiomatische Ausdrücke und kulturelle Kontexte. Bei https://www.goethe.de finden sich gute Ressourcen für Deutsch als Geschäftssprache.
Mangelndes aktives Zuhören
Was blockiert gute Kommunikation, selbst wenn alle dieselbe Sprache sprechen? Die Unfähigkeit zuzuhören. Ich beobachte es täglich: Während jemand spricht, planen die meisten bereits ihre Antwort, statt wirklich zuzuhören. Das ist kein böser Wille, sondern unser Gehirn, das schneller arbeitet als gesprochene Sprache.
In einem kritischen Kunden-Meeting 2021 erlebte ich die Konsequenzen hautnah. Unser Verkaufsleiter unterbrach den Kunden dreimal, um Lösungen anzubieten, bevor der Kunde überhaupt sein Problem vollständig geschildert hatte. Wir verloren den Deal an einen Konkurrenten, der einfach besser zugehört hatte.
Die Statistiken sind ernüchternd: Die meisten Menschen erinnern sich nur an 25-50% dessen, was sie hören. Der Rest geht verloren in mentalen Ablenkungen, Vorurteilen oder dem Drang, zu antworten. Was blockiert gute Kommunikation hier? Unser Ego, das beweisen will, dass wir die Antwort bereits kennen.
Was ich in meinen Teams eingeführt habe: Die 3-Sekunden-Regel. Nach einer Aussage warten wir bewusst drei Sekunden, bevor wir antworten. Klingt simpel, aber es zwingt zum Nachdenken statt zum Reagieren. Zusätzlich praktizieren wir “aktives Zuhören” – wir wiederholen das Gehörte in eigenen Worten, bevor wir unseren Punkt vorbringen.
Die Auswirkungen waren messbar: Meetings wurden effizienter, weil weniger Zeit mit Missverständnissen verschwendet wurde. Mitarbeiter fühlten sich wertgeschätzter, weil sie wirklich gehört wurden.
Fehlende Feedback-Kultur
Ein massives Problem, das die Kommunikation blockiert: Die Angst vor ehrlichem Feedback. Was blockiert gute Kommunikation in diesem Kontext? Die Sorge, Beziehungen zu schädigen oder als negativ wahrgenommen zu werden. Ich habe Teams geleitet, in denen niemand dem anderen ehrliches Feedback gab – bis Probleme explodierten.
Die Lösung liegt nicht in mehr Feedback, sondern in strukturiertem Feedback. Ich nutze das SBI-Modell (Situation, Behaviour, Impact), aber ohne den Consulting-Jargon. Statt zu sagen “Deine Präsentation war schlecht”, sage ich: “In der Kunden-Präsentation gestern (Situation) hast du die technischen Details betont (Behaviour), was dazu führte, dass der Kunde die Business-Benefits nicht verstand (Impact).”
Was funktioniert: Regelmäßige, kurze Feedback-Sessions statt große Jahresgespräche. Bei uns gibt es wöchentliche 10-Minuten-Check-ins, in denen ein positives und ein Verbesserungs-Feedback ausgetauscht wird. Nach drei Monaten wird Feedback zur Normalität, nicht zur Bedrohung.
Wichtig: Feedback muss in beide Richtungen fließen. Ich frage mein Team aktiv: “Was kann ich besser machen?” Diese Verletzlichkeit schafft psychologische Sicherheit.
Technologische Barrieren und Tool-Chaos
Was blockiert gute Kommunikation in modernen Unternehmen? Oft sind es die Tools, die eigentlich helfen sollten. Ich habe Unternehmen gesehen, die zehn verschiedene Systeme nutzen – CRM, Projektmanagement, Dokumentation, Chat, Video, Intranet, und so weiter. Jedes Tool hat seine eigenen Informationssilos.
Ein weiteres Problem: Jedes Tool bringt seine eigene Lernkurve mit. Neue Mitarbeiter brauchen Wochen, um sich in der Tool-Landschaft zurechtzufinden. Ältere Kollegen verweigern sich manchmal ganz und bleiben bei E-Mail, wodurch wichtige Informationen verpasst werden.
Was ich empfehle: Tool-Konsolidierung. Wählen Sie maximal drei Haupt-Tools – einen für Kommunikation, einen für Projektmanagement, einen für Dokumentation. Alles andere eliminieren. Bei einem mittelständischen Unternehmen führte diese Reduktion von 12 auf 3 Tools zu einer Effizienzsteigerung von 30% in der Kommunikation.
Der Schlüssel ist Standardisierung. Jeder muss wissen: Für diese Art von Kommunikation nutzen wir dieses Tool. Keine Ausnahmen, keine persönlichen Präferenzen. Das mag restriktiv klingen, aber es schafft die Klarheit, die effektive Kommunikation braucht.
Emotionale Intelligenz und zwischenmenschliche Konflikte
Was blockiert gute Kommunikation auf der menschlichen Ebene? Mangelnde emotionale Intelligenz und ungelöste zwischenmenschliche Konflikte. Ich habe erlebt, wie zwei hochqualifizierte Fachleute ein ganzes Projekt sabotierten, nur weil sie sich persönlich nicht ausstehen konnten.
Was ich gelernt habe: Emotionale Konflikte lösen sich nicht von selbst. Sie eskalieren. Die Lösung erfordert direkte Intervention. Ich moderierte ein klärendes Gespräch, in dem beide Parteien ihre Perspektiven darstellen mussten – ohne Unterbrechung. Der Durchbruch kam, als beide erkannten, dass ihre Konflikte aus Missverständnissen entstanden, nicht aus fundamentalen Differenzen.
Emotional intelligente Kommunikation bedeutet: Trennen Sie die Person vom Problem. Statt “Du bist schwierig” sage ich “Dieses Verhalten in dieser Situation führt zu diesem Problem”. Es geht um beobachtbares Verhalten, nicht um Charakterurteile.
Ein praktischer Tipp: Implementieren Sie eine Konfliktlösungs-Policy. Bei uns gilt: Wenn zwei Personen dreimal über dasselbe Thema streiten, wird automatisch ein neutraler Dritter einbezogen. Das verhindert, dass Konflikte chronisch werden und die Kommunikation langfristig vergiften.
Fazit
Was blockiert gute Kommunikation? Die Antwort ist komplex, denn es ist selten ein einzelner Faktor. In 15 Jahren Führungserfahrung habe ich gelernt: Die größten Kommunikationsbarrieren entstehen aus mangelnder Klarheit, hierarchischen Strukturen, Informationsüberflutung, kulturellen Unterschieden, fehlendem aktivem Zuhören, unzureichender Feedback-Kultur, Tool-Chaos und emotionalen Konflikten.
Die gute Nachricht: Alle diese Barrieren sind überwindbar. Es erfordert bewusste Anstrengung, systematische Prozesse und vor allem die Bereitschaft, alte Muster zu hinterfragen. Die Unternehmen, die ich begleitet habe und die ihre Kommunikation verbesserten, sahen messbare Ergebnisse – kürzere Projektlaufzeiten, höhere Mitarbeiterzufriedenheit und bessere Geschäftsergebnisse.
Mein Rat: Starten Sie klein. Identifizieren Sie die größte Kommunikationsbarriere in Ihrem Unternehmen und adressieren Sie diese zuerst. Perfektion ist nicht das Ziel – kontinuierliche Verbesserung ist es. Jede kleine Verbesserung in der Kommunikation zahlt sich exponentiell aus, weil Kommunikation das Fundament für alles andere ist.
Die Frage ist nicht, ob Sie Kommunikationsbarrieren haben – jedes Unternehmen hat sie. Die Frage ist, ob Sie bereit sind, sie systematisch anzugehen. Was blockiert gute Kommunikation in Ihrem Unternehmen? Wenn Sie diese Frage ehrlich beantworten können, haben Sie den ersten Schritt zur Verbesserung bereits gemacht.
Wie erkenne ich Kommunikationsbarrieren in meinem Team?
Achten Sie auf Warnsignale wie häufige Missverständnisse, verzögerte Projektumsetzungen, frustrierte Mitarbeiter oder wichtige Informationen, die nicht alle erreichen. Regelmäßige anonyme Umfragen und offene Team-Retrospektiven helfen, versteckte Kommunikationsprobleme aufzudecken. Beobachten Sie auch Meeting-Dynamiken – wer spricht, wer schweigt, wo entstehen Spannungen.
Was sind die Kosten schlechter Kommunikation für Unternehmen?
Studien zeigen, dass schlechte Kommunikation Unternehmen durchschnittlich 25-30% der Produktivität kostet. Das manifestiert sich in verschwendeter Arbeitszeit durch Missverständnisse, doppelte Arbeit, verzögerte Entscheidungen, verpasste Chancen und höhere Mitarbeiterfluktuation. Bei einem mittelständischen Unternehmen mit 100 Mitarbeitern können die jährlichen Kosten leicht sechs- bis siebenstellige Beträge erreichen.
Wie verbessere ich die Kommunikation in hierarchischen Organisationen?
Schaffen Sie sichere Kommunikationskanäle, bei denen Mitarbeiter ohne Angst vor Konsequenzen sprechen können. Führen Sie regelmäßige Skip-Level-Meetings ein, bei denen Führungskräfte direkt mit Teams zwei Ebenen unter sich sprechen. Belohnen Sie ausdrücklich das frühe Melden von Problemen. Praktizieren Sie “Management by Walking Around” – seien Sie sichtbar und zugänglich, nicht nur in formellen Meetings.
Welche Tools helfen wirklich bei besserer Kommunikation?
Weniger ist mehr – konzentrieren Sie sich auf maximal drei Haupt-Tools. Ein Kommunikationstool für synchrone und asynchrone Gespräche, ein Projektmanagement-Tool für Aufgaben und Deadlines, und ein Dokumentations-Tool für Wissensmanagement. Die beste Technologie nutzt nichts ohne klare Nutzungsrichtlinien. Definieren Sie präzise, wann welches Tool für welche Art von Kommunikation verwendet wird.
Wie kann ich als Führungskraft aktives Zuhören fördern?
Seien Sie selbst Vorbild – unterbrechen Sie nicht, halten Sie Blickkontakt, stellen Sie klärende Fragen. Implementieren Sie in Meetings die Regel, dass jeder ausreden darf ohne Unterbrechung. Üben Sie die Technik des Paraphrasierens – wiederholen Sie das Gehörte in eigenen Worten zur Bestätigung. Schulen Sie Ihr Team in aktiven Zuhörtechniken und machen Sie diese zu einem bewertbaren Teil der Leistungsbeurteilung.
Was ist der größte Fehler bei virtuellem Arbeiten in Bezug auf Kommunikation?
Der größte Fehler ist, analoge Kommunikationsmuster eins zu eins auf digitale Formate zu übertragen. Virtuelle Kommunikation erfordert mehr Struktur, klarere Agenden, häufigere Check-ins und bewusstere Beziehungspflege. Viele Teams kompensieren fehlende physische Präsenz mit zu vielen Meetings, was zu Zoom-Fatigue führt. Stattdessen: Asynchrone Kommunikation für Updates, synchrone Kommunikation nur für Diskussionen und Entscheidungen.
Wie gehe ich mit Teammitgliedern um, die sich nicht an Kommunikationsregeln halten?
Sprechen Sie das Verhalten direkt an, aber privat und konstruktiv. Erklären Sie die konkreten Auswirkungen ihres Verhaltens auf das Team. Oft sind sich Menschen ihrer Kommunikationsfehler nicht bewusst. Bieten Sie Unterstützung und Training an. Bei wiederholtem Fehlverhalten müssen klare Konsequenzen folgen – nicht als Bestrafung, sondern als notwendige Maßnahme für effektive Teamarbeit.
Wie wichtig ist nonverbale Kommunikation im Geschäftskontext?
Nonverbale Kommunikation macht über 70% der Gesamtkommunikation aus. Körpersprache, Tonfall, Mimik und Gesten vermitteln oft mehr als Worte. In virtuellen Settings geht viel davon verloren, was Missverständnisse begünstigt. Achten Sie auf Kamera-Winkel, Beleuchtung und Hintergrund in Videocalls. Bei wichtigen Gesprächen bevorzugen Sie persönliche Treffen oder zumindest Video statt reiner Audio-Kommunikation.
Wie schaffe ich eine Feedback-Kultur in traditionellen Unternehmen?
Starten Sie mit regelmäßigem, strukturiertem Feedback von oben nach unten – zeigen Sie Verletzlichkeit und Offenheit für Kritik. Führen Sie 360-Grad-Feedback schrittweise ein, beginnend mit kleinen Pilotteams. Machen Sie Feedback zu einem normalen, nicht bedrohlichen Teil der Arbeitskultur durch kurze, häufige Check-ins statt seltener, formeller Evaluationen. Schulen Sie alle in konstruktiven Feedback-Techniken und machen Sie positive Beispiele sichtbar.
Was kann ich gegen E-Mail-Überflutung tun?
Etablieren Sie klare E-Mail-Richtlinien: Welche Themen gehören in E-Mails, welche in andere Kanäle? Nutzen Sie die “5-Sätze-Regel” für E-Mails. Implementieren Sie E-Mail-freie Zeiten für konzentriertes Arbeiten. Schulen Sie Teams in effizienter E-Mail-Kommunikation – klare Betreffzeilen, strukturierte Inhalte, eindeutige Handlungsaufforderungen. Nutzen Sie Projektmanagement-Tools für aufgabenbezogene Kommunikation statt E-Mail-Ketten.
Wie kommuniziere ich schwierige Entscheidungen effektiv?
Bereiten Sie die Kommunikation sorgfältig vor: Erklären Sie den Kontext, die Entscheidungsfindung, die Auswirkungen und die nächsten Schritte. Seien Sie ehrlich über negative Aspekte – Beschönigung zerstört Vertrauen. Kommunizieren Sie persönlich bei bedeutenden Änderungen, nicht per E-Mail. Geben Sie Raum für Fragen und Emotionen. Folgen Sie mit schriftlicher Dokumentation nach. Wichtig: Kommunizieren Sie rechtzeitig, nicht im letzten Moment.
Wie fördere ich offene Kommunikation in kulturell diversen Teams?
Investieren Sie Zeit in kulturelles Bewusstsein – organisieren Sie Workshops, wo Teams ihre Kommunikationspräferenzen teilen. Etablieren Sie einen gemeinsamen Kommunikationsstandard, der Elemente verschiedener Kulturen integriert. Dokumentieren Sie wichtige Informationen schriftlich, um Sprachbarrieren zu überwinden. Schaffen Sie psychologische Sicherheit, wo Nachfragen erlaubt und erwünscht ist. Nutzen Sie visuelle Hilfsmittel und Beispiele zur Verdeutlichung komplexer Konzepte.
Welche Rolle spielt Transparenz für gute Kommunikation?
Transparenz ist fundamental für Vertrauen und effektive Kommunikation. Teilen Sie Informationen standardmäßig, nicht auf Anfrage – “need to know” sollte “nice to know” werden, wo möglich. Erklären Sie die Gründe hinter Entscheidungen, nicht nur die Entscheidungen selbst. Seien Sie offen über Herausforderungen und Unsicherheiten. Transparenz bedeutet nicht, alles zu teilen, sondern relevant Informationen zugänglich zu machen.
Wie messe ich die Qualität der Kommunikation in meiner Organisation?
Nutzen Sie regelmäßige Mitarbeiterumfragen mit spezifischen Fragen zur Kommunikationsqualität. Messen Sie quantitative Indikatoren wie Meeting-Zeit, E-Mail-Volumen, Zeit bis zur Problemeskalation, Projektlaufzeiten. Führen Sie Kommunikationsaudits durch – analysieren Sie tatsächliche Kommunikationsflüsse und -muster. Beobachten Sie qualitative Indikatoren wie Mitarbeiterfluktuation, Konfliktanzahl, Innovationsrate. Kombinieren Sie mehrere Metriken für ein vollständiges Bild.
Was sind typische Kommunikationsfallen in Krisensituationen?
In Krisen neigen Organisationen zu zwei Extremen: Informationsstau aus Angst oder Informationsflut ohne Struktur. Typische Fehler sind verzögerte Kommunikation, widersprüchliche Botschaften von verschiedenen Führungskräften, mangelnde Empathie, fehlende klare Handlungsanweisungen und seltene Updates. In Krisen brauchen Menschen häufige, ehrliche, konsistente Kommunikation mit klarer Führung. Etablieren Sie einen Krisenkommunikationsplan vor der Krise, nicht mittendrin.
Wie verbessere ich die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen?
Schaffen Sie funktionsübergreifende Teams für wichtige Projekte. Organisieren Sie regelmäßige Abteilungs-Showcases, wo Teams ihre Arbeit präsentieren. Etablieren Sie gemeinsame Ziele und KPIs, die Zusammenarbeit erfordern. Implementieren Sie Job-Rotation oder Shadowing-Programme für besseres Verständnis. Brechen Sie Silos durch gemeinsame Räume, Events und informelle Austauschmöglichkeiten. Adressieren Sie Kommunikationsbarrieren zwischen Abteilungen in Führungsmeetings als strategische Priorität.